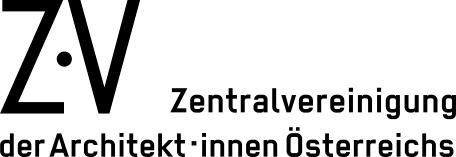2025 wurden aus 112 Einreichungen und 24 Nominierungen schließlich sieben Projekte von der Hauptjury mit dem österreichischen Bauherr:innenpreis ausgezeichnet.
Wir gratulieren allen Mitwirkenden ganz herzlich zu den gelungenen Projekten!
Architektur beginnt mit einer Entscheidung
Zeit lassen ist keine Eigenschaft der Gegenwart – alles soll so schnell wie möglich gehen. Der jährlich vergebene Bauherr:innenpreis verstößt mit selbstbewusster Lässigkeit gegen diese Beschleunigung. Auf der Suche nach Architekturqualität nimmt er sich Zeit. Zunächst sichten lokale Juries in allen österreichischen Bundesländern Bauten, Freiräume und städtebauliche Situationen, prüfen sie vor Ort und nominieren sie. Dann folgt die nationale Jury, die in einer knappen Woche zweieinhalbtausend Kilometer quer durch Österreich reist, um die Finalisten selbst zu begutachten und schließlich die Preisträger:innen zu bestimmen.
Öffentlich, aber nicht im Rampenlicht
Zu dieser Geduld gesellt sich ein besonderer Fokus. Denn prämiert werden nicht die Architekt:innen – die als Autor:innen ihrer Werke ohnehin meist im Rampenlicht stehen –, sondern die Bauherrinnen und Bauherren. Darin liegt die Raffinesse des Preises, aber auch seine Schwierigkeit. Die Rolle der Bauherr:in – Commissioner im Englischen, Maître d’Oeuvre im Französischen – von der Qualitätsseite her zu betrachten, hat international kaum Vorbilder. Wer also genau wird hier ausgezeichnet?
Zwar existieren Untersuchungen zur privaten Bauherr:in – etwa wenn die Raiffeisenkasse das Nachhaltigkeitsbewusstsein von Einfamilienhausbesitzer:innen erforscht, oder wenn in Deutschland der Deutsche Städtetag den sogenannten „Bauherrenpreis“ für Geschoßwohnbauten vergibt. Doch letzterer bezieht sich auf Projekte der Wohnungswirtschaft und bleibt auf diese Branche beschränkt. Es gibt europaweit zahlreiche wissenschaftliche Analysen zu Kosten, Projektabläufen, Realisierungsstrategien und der damit verknüpften Rolle der Auftraggeber:innen. Doch die Frage nach der Baukultur taucht, wenn überhaupt, nur am Rande auf.
Beim Bauherr:innenpreis, den die ZVÖ seit 1967 jährlich verleiht, verhält es sich „the other way round“: Im Mittelpunkt steht die Frage nach den Bedingungen von Architekturqualität – und mit ihr die Baukultur in Österreich.
9 Bundesländer, 24 nominierte Projekte
Wie lässt sich dieser Fokus fassen? Die Umkehrung des Blicks auf die Rolle der Bauherr:in hat uns als Jury – Anne Beer, Günter Mohr und mich – während unserer Fahrt durch neun österreichische Bundesländer begleitet: auf Autobahnen, Landstraßen, Alpenpässen. Welchem Selbstverständnis der Bauherr:in würden wir begegnen, wenn wir das Verhältnis von guter Architektur und Bauherr:innentätigkeit untersuchten?
Zu Beginn der Reise klangen uns noch die gewohnten Stimmen der Architekt:innen im Ohr: „Unser Verhältnis zur Bauherrschaft war hervorragend – Konflikte wurden im direkten Austausch gelöst, und so entstand ein tolles Projekt.“ Schnell wurde klar, dass es sich dabei um eine idealisierte Figur handelt, derzufolge die Architekt:in nur freie Hand zu bekommen braucht. Doch während unserer Gespräche mit Auftraggeber:innen und Architekt:innen vor Ort hörten wir andere Töne.
Die Themen, die in den rund einstündigen Präsentationen aufkamen, waren so vielfältig wie die Bauten selbst: der Umgang mit dem eigenen Erbe; die Überraschung, plötzlich Bauherr:in zu sein; die Herausforderung minimaler Budgets bei öffentlichen Projekten; das Wagnis des finanziellen Risikos; Lernprozesse im Umgang mit rechtlichen und normativen Vorgaben; eine lebenslange Nähe zur Architektur; eine von Bundesland zu Bundesland verschiedene Einstellung zu lokaler Prozesskultur und Handwerk; das spontane Verantwortungsgefühl gegenüber der Stadtgeschichte; die Frage, ob ein Gebäude heute wieder hundert und mehr Jahre halten sollte.
Die Frage „Was heißt gutes Bauen?“ wurde in einer Zeit, in der sich Wertmaßstäbe unter ökologischen Prämissen grundlegend verschieben, oft tastend, aber mit bewundernswertem Engagement beantwortet. Die Spannweite reichte vom individuellen Bekenntnis – „Ich wollte etwas Ikonisches bauen, und das ist mithilfe der Architekt:innen gelungen“ – bis zur öffentlichen Verantwortung: „Ich bin, stellvertretend für die öffentliche Hand, zuständig für 90 Gebäude. Ohne den Wettbewerb am Anfang hätten wir keine Qualität.“
Der erste Entschluss
Architektur beginnt – das wird leicht vergessen – weder mit dem Wettbewerb noch mit dem Entwurf, sondern mit einer Entscheidung. Jemand erklärt sich bereit, neuen Raum zu schaffen oder bestehenden zu verwandeln. In diesem Moment tritt die Bauherrschaft als Urheberin auf – nicht als entwerfende Gestalterin, sondern als jene, die Architektur ermöglicht. Ohne diesen ersten Schritt bliebe der Entwurf Skizze.
Ob es sich um einen Schulverein in Wien handelt, der die Waldorfschule erweitert, um den Erben eines Hotels in Vorarlberg, um die Marktgemeinden Prinzersdorf oder Hausmannstätten, die ein Vereinsheim oder einen Kindergarten errichten, oder um einen Arzt in Deutsch Kaltenbrunn, der ein Gesundheitszentrum auf dem Land baut – immer braucht es diese erste Entscheidung.
Bei öffentlichen Projekten liegen die Bedürfnisse meist offen auf dem Tisch: Der Bedarf ist da, es fehlen etwa Kindergartenplätze oder Räume für das Gemeindehaus. Die eigentliche Herausforderung liegt in der Finanzierung, in Fördermitteln und politischen Verfahren. Ist das geklärt, fällt die Entscheidung fürs Bauen leicht.
Komplexer wird es, wenn – wie beim Mariendom in Linz – eine Stiftung, die für den Erhalt zuständig ist, über die Möglichkeiten einer zusätzlichen „Öffnung“ des hundert Jahre alten, denkmalgeschützten Bauwerks nachdenkt. Der neue Eingangspavillon von Peter Haimerl erfüllt die denkmalpflegerischen Bedingungen und hat den Dom tatsächlich zur Stadt hin geöffnet; die Architektur der hängenden Baldachindächer hat viele lobende Veröffentlichungen bewirkt. Doch der aufwändige Bauprozess selbst, die Risikobereitschaft der Auftraggeber:innen, bleiben im Rückblick unsichtbar. Ohne diesen Mut wäre gute Architektur nicht denkbar. Der Dommeister Clemens Pichler übergeht die anfängliche Kritik, die dem Projekt aus der Stadt entgegenschlug, mit Nonchalance: „Kirche war immer innovativ. Meine Aufgabe war nur, dass der Dom wieder mehr in die Mitte der Stadt rückt.“
Privat gebaut, öffentlich wirksam
Ein Haus entsteht aus privatem Interesse – und wirkt doch, sobald es zwischen Nachbarn steht, öffentlich. Eine Bauherrschaft, die sich dieser Konstellation bewusst ist, schafft nicht nur ein nutzbares Objekt, sondern eine kulturelle Geste – im Quartier, in der Landschaft, in der Stadt.
Eine der Bauherrinnen, die Betreiberin des Salzburger Hotels „Zum Hirschen“, nutzte den Umbau, um den Baublock nahe dem Bahnhof um eine Wohnanlage und einen großen begrünten Innenhof zu erweitern – eine bedeutende Investition, die der Stadt dringend benötigten Grünraum schenkte. Keine einfache Bauaufgabe, zumal die Finanzierung während der Corona-Zeit gesichert werden musste.
In der Steiermark konnte ein Zimmermeister die benachbarte Pfarrei erwerben - unter der Bedingung, ein passendes Nutzungskonzept zu entwickeln. Heute beherbergt der aufwändig sanierte Bau von 1775 Übernachtungsmöglichkeiten und ist ein vorbildlich geglücktes Beispiel für die Freilegung historischer Substanz. Auch wenn die Anlage kein billiges Refugium ist, bleibt sie Teil des Dorflebens: Im Garten feiert die Dorfgemeinschaft, und die Kirche wird bei Festen aus der hauseigenen Küche versorgt. „Wir sind gerne Gastgeber“, sagt der Bauherr.
Selbstlos ist dieses Engagement nicht – dafür ist das Risiko zu groß. Doch in allen 24 nominierten Projekten wurde ein außergewöhnliches Bewusstsein für den gestalteten Raum sichtbar, verbunden mit der Erkenntnis, dass gute Architektur anstrengend ist. Oder, wie eine Bauherrin sagte: „Es war viel Arbeit, aber wir konnten ein Stück neue Öffentlichkeit schaffen.“
Mut zur Korrektur
Ob ein Gebäude ökologisch überzeugt, hängt selten allein von technischen Parametern ab. Entscheidend ist der Wille der Auftraggeber:innen, sich auf neue, zukunftsfähige Bauweisen einzulassen – auch wenn das Mehrkosten bedeutet. Baukultur entsteht heute dort, wo Energieeffizienz, CO₂-Einsparung und Lebenszykluskosten in den Vordergrund rücken.
Solche Prozesse verlaufen nicht geradlinig. Sie erfordern Neugier, Geduld und die Bereitschaft, Entscheidungen während der Bauphase zu überdenken. Wie sehr sich der ökologische Fortschritt in zwanzig Jahren verschoben hat, zeigte der Erweiterungsbau der Firmenzentrale „Windkraft Simonsfeld“ in Ernstbrunn. Dem pionierhaften, aber wenig flexiblen Ursprungsbau aus der Frühzeit des ökologischen Bauens steht nun ein anpassungsfähiger Neubau gegenüber. „Das nachhaltigste Konzept ist eines, das möglichst lange gut nutzbar bleibt“, lautete die gemeinsam von Architekt und Bauherr getragene Devise.
Mut zur Selbstkorrektur ist auch dort nötig, wo im Wohnungsbau private Entwickler und städtische Wohnbaugesellschaften den Bedarf an bezahlbaren Wohnungen mit immer gleichen, eingespielten Routinen beantworten. Die Veränderungen heutiger Lebensbedingungen, angefangen vom Homeoffice und den sich ändernden Grenzen zwischen Wohnen und Arbeiten, fallen unter den Tisch. Dass es anders geht, zeigt der Loft-Flügel in Wien. Innerhalb eines offenen Raumgerüsts sind unterschiedlichste Nutzungen gerade bei kleinen Wohnungen möglich – ein Beispiel, das Schule machen sollte.
Bindende Ausführungsvorschriften und Alternativen
Sparsamkeit um jeden Preis gilt in Zeiten knapper Kassen als oberstes Prinzip – mit der Folge, dass Architekt:innen immer weniger Spielraum haben und die langfristige Haltbarkeit aus dem Blick gerät. Wir hörten auf der Reise von Katalogen der öffentlichen Hand, die verpflichtende Billigst-Standards bis ins Detail festlegen, nach denen im geförderten Wohnungsbau gebaut werden muss. Selbst wenn Architekt:innen kostengünstigere oder langlebigere Alternativen vorschlagen, sind sie daran gebunden. Ähnlich restriktiv präsentiert sich mancherorts der öffentliche Schulbau, wo Möblierungen in Einheitsserien vorgeschrieben werden: Schränke, Tische und Stühle, die nach wenigen Jahren ersetzt werden müssen – Wegwerfdesign als Norm.
Dass es auch anders geht, zeigen Projekte wie die Campuserweiterung „House of Schools“ in Linz, deren offenes, mehrgeschoßiges Atrium mit kleinen Besprechungsinseln eine andere Lernkultur sichtbar macht. Oder die Landwirtschaftliche Fachschule Winkelhof, wo sich die öffentliche Auftraggeber:in konsequent für den Einsatz regionaler, nachwachsender Materialien einsetzte und die Architekt:innen Räume schufen, die das Lernen mit der Praxis verbinden – Werkstätten, Stallungen und Unterrichtsräume als zusammenhängender Erfahrungsraum.
Geteiltes Risiko
Umgangssprachlich wird der Begriff „Bauherr:in“ gern im Singular verwendet. Doch bei etwa der Hälfte der Projekte gab es kein Einzelinteresse, sondern Teams aus mehreren Auftraggeber:innen. Architekt:innen, die für Vereine, Gemeinden oder Genossenschaften bauen, begegnen einer Vielzahl von Stimmen, Interessen und Zuständigkeiten. Wie produktiv solche Vielstimmigkeit sein kann, zeigte der wunderbare kleine Museumsumbau in Bezau, bei dem der lokale Museumsverein in einem mehrjährigen Prozess die Umsetzung gestemmt hat. Es ist auch ein Vorbild für die beispielhafte Zusammenarbeit zwischen Architekten und örtlichem (Holz-)Handwerk. Geld war kaum vorhanden, aber dann wurde eben der eine oder andere Baumstamm gespendet, der heute die Fassade prägt.
Solche Abstimmungsprozesse können aufwändig sein, so gesehen beim Flusshaus in Prinzersdorf. Architekt:innen und Bürgermeister schilderten bei der Präsentation, wie die örtliche Musikkapelle und die Yogagruppe monatelang um die Aufteilung des Mehrzwecksaals stritten – bis die Architekt:innen eine verschiebbare Wand entwickelten, inspiriert vom System von Bibliotheksarchiven. Entstanden ist ein Raum, der unterschiedliche Interessen vereint.
Am Ende dieser einwöchigen Exkursion im Juli 2025 zu den Bauherr:innen von 24 herausragenden Bauten richtet sich der Blick wieder auf die Architekt:innen. Sie haben jene vorbildlichen Werke geschaffen, die uns auf die Reise schickten.
Hans Hollein, der 1967 an der Konzeption des Preises beteiligt war, sprach von einem „dialektischen Vorgang zwischen Architekt und Bauherrn, der sich in qualitätvoller, unkonventioneller, an- und aufregender, exemplarischer und zukunftweisender Architektur und gemeinsamer Aktion niederschlägt – oft gegen große Widerstände.“ Diese prägnante Beschreibung des Duos Architekt:in und Bauherr:in gilt bis heute.
Kaye Geipel, Oktober 2025
WIR GRATULIEREN GANZ HERZLICH: